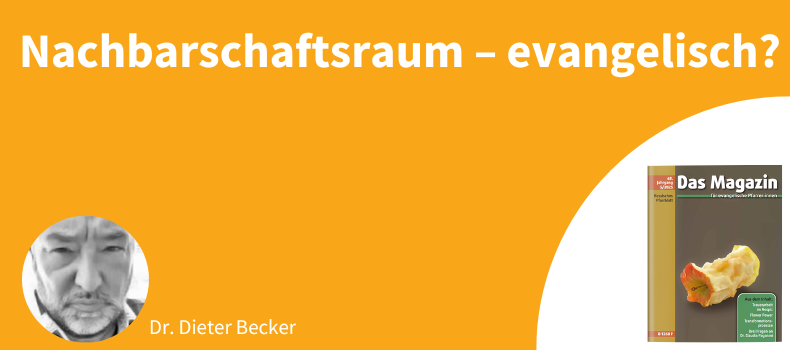
Anmerkungen zu neuen Formen in evangelischen Kirchen
Zu einem der wesentlichsten Elemente der Reformation zählte – neben den theologisch bedeutsamen Sola/Solus-Aussagen (allein Bibel, allein Gnade, allein Christus, allein Glaube) – die strukturelle Bedeutsamkeit der „Gemeinde” als Grundinstanz des Lutherischen, Reformierten, Protestantischen und damit Evangelischen.
Luther verfasste im Jahr 1523 an die Gemeinde in Leisnig das Schreiben „Dass eine christliche Versammlung oder Gemeinde Recht und Macht habe, alle Lehre zu urteilen und Lehrer zu berufen, ein- und abzusetzen. Grund und Ursache aus der Schrift“ [WA 11, (401–407) 408–416].
Aufbauend auf der Erkenntnis, dass es die christliche Gemeinde und deren Glieder sind, die Kirche/Gemeinschaft im biblischen Sinne ausmachen, gestaltet er (Luther) ein Pfarrbild aus der Perspektive der Gemeinde. Die allgemein gehaltene Schrift wurde veranlasst durch eine Anfrage der Leisniger Gemeinde (zwischen Dresden und Leipzig gelegen). Luther legt in ihr die Bedeutung (Auswahl des Pfarrkandidaten), die Ausrichtung (pastorale Aufgaben) und die Organisationsstruktur (Pfarrwahl) eines evangelischen Pfarramtes dar. Zudem entwickelt er in dieser programmatischen Schrift ein Verfahren, wie Gemeinden sich ihre eigenen Pfarrer bzw. Lehrer aussuchen sollen.
Eine Gemeinde, die das wahre Evangelium predigt, kennt …
- die wahren Lehrer,
- kann falsche Propheten von den richtigen unterscheiden,
- prüft alles und behält das Gute und
- lässt sich nicht zur falschen Lehre verführen, weil sie eben alle Lehre beurteilt.
Luther folgert nun daraus, dass eine christliche Gemeinde, die das Evangelium predigt, sich der katholischen Obrigkeit (dem Bischof, Kloster oder Stift, die im katholischen Recht die Priesterbesetzung vornehmen) entzieht. Die Gemeinde, die bei Luther häufig mit der realen Kirchengemeinde assoziiert wird, ist gerufen, sich selbst einen Pfarrer bzw. einen Prediger zu wählen.
Grundsätzlich unterscheidet Luther zwei Aspekte im Blick auf die pastorale Tätigkeit:
a) Wo es keine Christen gibt, ist jeder Christ zum Pfarrer bzw. zum Priester gerufen, das Evangelium zu verkünden.
b) Wo eine Gemeinde aus Christen besteht, ist ein Pfarrer bzw. ein Prediger von der Gemeinde her zu wählen.
Hier wird das Moment der Basiswahl eines Pfarrers propagiert, die Luther auch später immer als notwendige Voraussetzung ansieht. Die Gemeinde bzw. die Gremien der christlichen Gemeinde haben das Recht, Lehre zu beurteilen und Pfarrer zu wählen.
Die Voraussetzungen zum Pfarrberuf sind bei Luther ähnlich denen, die er für die Erfüllung eines jeden Berufs ansieht. Die Eignung zum Pfarrberuf sieht Luther in drei Aspekten [WA 11, S. 411, Z. 28–30] gegeben:
- Empfehlung und grundsätzliche Eignung bzw. Geschicklichkeit („So man geschickt dazu findet“)
- Intellekt und Verständigkeit („die Gott mit Verstand erleucht“)
- Befähigung und pastorale Gaben („mit Gaben dazu geziert sind“)
(aus: DB, Pfarrberufe zwischen Praxis und Theorie)
Theologiegeschichtlich wurde dies dann bei Peter Blickle thematisch unter dem Begriff der „Gemeindereformation” (Gemeindereformation – Die Menschen des 16. Jahrhunderts auf dem Weg zum Heil, 1987) als strategisches Strukturkonzept nachgezeichnet.
Zeitgeschichtlich hatten die Ausführungen Luthers unmittelbare politische Auswirkungen. In den berühmten zwölf Artikeln der Bauern (vgl. de.wikipedia.org/wiki => Zwölf Artikel) forderten die Bauernvertreter in Memmingen im März 1525 wesentliche Menschen- und Grundrechte ein.
Artikel 1 der Bauern lautet: „Jede Gemeinde soll das Recht haben, ihren Pfarrer zu wählen und ihn zu entsetzen (abzusetzen), wenn er sich ungebührlich verhält. Der Pfarrer soll das Evangelium lauter und klar ohne allen menschlichen Zusatz predigen, da in der Schrift steht, dass wir allein durch den wahren Glauben zu Gott kommen können.“
Das „Gemeindepfarramt“ ist das Pfarramt in und der Kirchengemeinde. Der Gemeindepfarrer, seit den 1970er Jahren auch Gemeindepfarrerin, ist in die lokale Struktur – im Leben, im Alltag und im Glauben der Orts-Evangelischen – eingebunden und kein „Gegenüber“ oder eine priesterliche Sonderperson.
Man muss sich vor Augen halten, dass die identitätsstiftende Grundlage des Evangelischen in der Gemeinde liegt; und zwar die lokale Ortsgemeinde. Hier spiegelt sich evangelisches Leben im Alltag und nicht in einer privatimen Vereinsstruktur. „Kirche“ ist immer zuerst konkret Gemeinde und nicht bzw. niemals „Kirche in ihrer Unbestimmtheit“ einer statuierten Rechtsform (v. Harnack); von wem auch immer gebildet.
Kongregationale (als Gemeinde organisierte), presbyteriale (in gemeindlichen Presbyterien, Vorständen und Synoden organisierte) oder eher episkopale (in eher hierarchischer Struktur organisierte) Strukturformen von „Kirche“ finden sich auch im Evangelischen. Kern bleibt dennoch die „personal-lokale Verortung“ der Pfarrperson als „Teil einer Gemeinde“ im und mit deren Leben, Alltag und Glauben; bis 2023. Denn im Dezember 2023 beschloss die EKHN-Synode nach 500 Jahren: „Kirchengemeinden werden Pfarrstellen zugeordnet.“
§ 5 Abs. 1 Kirchengesetz zur Regelung des Pfarrstellenrechts bis zur Neufassung des Pfarrstellengesetzes vom 02.12.2023 (kirchenrecht-ekhn.de => Nr. 400a): „Bis zur Verabschiedung einer gemeinsamen Dienstordnung für den hauptamtlichen Verkündigungsdienst erfolgt die Zuordnung von Kirchengemeinden zu den Pfarrstellen durch eine Anlage zum Sollstellenplan, in der auch der Dienstsitz der gemeindlichen Pfarrstellen festgelegt wird.“
Formal wurden dann zum 01.01.2025 alle Gemeinde-Pfarrstellen in den Kirchengemeinden aufgelöst und beim Dekanat (Kirchenkreis) errichtet. Hierarchisch werden diese Stellen top-down aus dem EKHN-Haushalt (Stellenplan) als Planzahlen den Dekanaten zugewiesen, die diese „verteilen“.
Aus dem generellen Gemeindepfarramt wird nun ein funktionales Pfarramt mit einer Gemeindezuordnung von oben, bei denen die Pfarrpersonen auch ihre Stellung im Kirchenvorstand bis 2027 spätestens verlieren. Die Funktionen des Gemeindepfarramtes nach Karl-Wilhelm Dahm (Beruf: Pfarrer, 1971), Wertevermittlung und Lebensbegleitung als personale Pflicht der Pfarrperson in der Gemeinde, wird nun also zu funktionalisierender Arbeitsteilung in einem „Nachbarschaftsraum“ bestimmt.
Die Größen der „Gemeinde-Räume“ wurden dabei bisher nach Gemeindegliedern bestimmt, nunmehr – in Umkehrung des Prinzips – von der Anzahl der „hauptamtlichen Personen“.
So werden auch aktuell evangelische „Mega-Churches in der EKHN“ ins Auge gefasst, bei denen sogar alle Kirchengemeinden eines Dekanats (also ca. 40–63 Einzelgemeinden bisher) in einer Gesamtkirchengemeinde mit ca. 40.000–50.000 Mitgliedern „erprobt“ werden sollen (Dekanat Mainz bzw. Alzey-Wöllstein). Der „Gesamtkirchenvorstand“ wird dann mit dem Dekanatssynodalvorstand bestimmt. Das Gemeindebüro ist im oder das Dekanatsbüro. Das Verkündigungsteam ist – fast bis auf wenige Dekanatsmitarbeitende (Dekanatspfarrstellen, Jugendreferent/in…) – der Konvent des Dekanates.
Neben dem Dekanatshaushalt gibt es nur noch den Haushaltsplan der Gesamtkirchengemeinde, der hoheitlich von den ca. 8–15 Personen (des DSV als Gesamtkirchen-KV) verwaltet und besorgt wird. Bezirksvorstände (ehemalige KVs der Kirchengemeinden) konzentrieren sich auf Basisdinge in Abhängigkeit vom DSV als Gesamt-KV.
Was auch immer die EKHN-Slogans „Vielfalt“, „Bunt“ oder „Facetten“ bedeutet, das neue Kirchenkreuzfahrtschiff (KKF) ist ein Konglomerat unendlicher, unübersichtlicher Deckklassen, Neigungs- bzw. Spaßregionen. Die Ideologie der Kirche-der-Freiheit-Strategie von 2006 lässt grüßen: Kirche als konzernhafter Supertanker statt gemeindlich-organisierten Boote. Ob Einheit nun die Vielfalt ausmacht und zudem Minderheiten die Mehrheiten bilden, bleibt eine Form der Gestaltung der nun neu hierarchisch-aristokratisch gestalteten Schiffklasse des Evangelischen.
Theologisch bedeutet in der EKHN die Fusion formal das Ende der Konfessionen. Art. 12, Abs. 2, KO: „In einer neu errichteten Kirchengemeinde wird das Bekenntnis in Bindung an den Grundartikel festgelegt.“ Insofern „verlieren“ fusionierte Nachbarschaftsräume als Ganzes ggf. bisher prägende konfessionelle „Bekenntnisse“, z. B. in Gottesdienst-Liturgie, in Sakraments-Liturgie oder KU-Grundlagen (Lutherischer oder Heidelberger Katechismus) ihre bisherige Bedeutung.
Das Evangelische machte bisher (seit 500 Jahren) in besonderer Art und Weise deutlich, dass das Evangelium in überschaubaren Gemeinden, in denen Evangelische leben und wirken, die weitgehend von der Organisations-Hierarchie unbestimmt das Evangelische gestalten und schwerpunktmäßig bestimmen durften.
Diese Gemeinde-Wege und Organisation waren kurz und betriebswirtschaftlich gesprochen: „schlank“. Glaube war vor Ort, sichtbar und „fassbar“ im Alltag in den dort ansässigen Menschen samt Pfarrperson verortet; das Heil des Evangeliums vor Ort in der Gemeinschaft um Jesus als Christus evangelisch verortet. Die Gemeinde war – bisher – Gestalter des Bottom-Up- und nicht Erfüller des Top-Down-Evangelischen.
Die nun erfolgte „Hierarchisierung“ der religiösen Struktur des Evangelischen erinnert eher an das katholische Ordnungskonzept des „pastoralen Raums“, der um den (Ober-)Priester gebildet wird. Die durch Luther und die damaligen Menschen – wie die Forderung der Bauern zeigte – gedachte „Entkoppelung von Hierarchie“ hin zur eigenverantwortlichen Gemeinschaft vor Ort wird strukturell aufgegeben. Aber wenn Hierarchie mehr Macht will, werden die strukturellen Rahmenbedingungen eben „größer“ gedacht oder gemacht, weil sich ein Supertanker mit zu viel an Vielfalt nicht steuern lässt.
Dass insgesamt überhaupt keine theologische oder evangelische Diskussion mehr im Blick ist, lässt sich an einer Aussage eines Landessynodalen messen. Auf Rückfrage, was er bzw. die Synode beschlossen habe, sagt er: „Woher soll ich das wissen, bis man es im Amtsblatt lesen kann.“ Auch eine Form von Basisdemokratie.
Kurz: Je größer die Gemeinde wird, desto weniger kann sie evangelisch sein, strukturell gesehen. Letztlich wollte Luther eine Gemeindereformation, wie Peter Blickle scharfsinnig herausarbeitete. Dazu zählt(e) als zwingendes Element, dass eine Kirchengemeinde als Gemeinde Jesu Christi die Instanz ist, einen Pfarrer zu wählen oder abzusetzen. Wichtig war nicht die Wahl, sondern das gemeinsame Leben als Evangelische.
Nun wird aber nicht mehr von Präsenzpflicht, geschweige denn von Residenzpflicht geredet, was vor 15 Jahren noch als pastorales Dogma galt. Die abgestimmten „Pastoral-Funktionen“ der jeweiligen Pfarrpersonen im Nachbarschaftsraum sind nicht zwingend general-gemeindlich wie bisher bestimmt, sondern funktional in Bezug auf kasuale Termine oder Veranstaltungen bezogen. Die Abarbeitung beruflicher Leistungsanforderungen ist keine persönliche Lebensforderung mehr in den gemeindlichen Alltag hinein.
Redet man mit jüngeren Pfarrpersonen wird dies ausdrücklicher gewünscht. Die vielfach gewünschte Professionalisierung lässt den Menschen im Amt vor Ort aus dem Blick geraten und den Profi im Gegenüber von (noch pastoral-konnotierten) Terminen entstehen. Funktionsbeschreibungen reden schon von „Pastoraltherapeuten“ statt Pfarrpersonen, die situativ-kasuistisch (quasi: pastoral-therapeutisch) und nicht im Lebensalltag als pastoraler Mit-Mensch begleiten.
Uta Pohl-Patalong redet dann …
a) kirchenstrukturell nicht mehr von einem „Flächenverständnis“ einer Landeskirche oder Ortsgemeinde, sondern von einem evangelischen Netzwerk an einigen (übrig bleibenden) Orten – meist Gebäuden; und
b) berufssoziologisch vom Wandel bisheriger lebensförmigen und nun einer neuen berufsförmigen Ausprägung pastoraler (Selbst-)Bestimmung [u.a. im DtPfrBlatt 7/2025 & Vortrag beim Pastor:innentag in Nordelbien].
Für das evangelische Morgen scheint zu gelten: Die aktuell konzipierte Mischform des Evangelischen von einer Gemeindeentkoppelung hin zu einer hierarchischen Kirchenstrukturobrigkeit birgt die Gefahr der Auflösung der pastoralen Alltagsaufgabe vor Ort. Dies war und ist – nach hiesiger Ansicht – das, was das Evangelische bisher besonders ausmachte. Nämlich, dass die Pfarrperson als Mit-Mensch in der Gemeinde auch gewisse pastorale Aufgaben wahrnimmt. Also nach Dahm: Eine Pfarrperson vor Ort – sichtbar und greifbar im Glauben an Jesus als Christus, die Wertevermittlung und Lebensbegleitung in aller Ambivalenz mit den Menschen lebt.
Man darf sich bewusst machen: Jede Form, der sich selbst explorierenden Ämter und Strukturen führt zu einer evangelischen Reformation.
Warum der Protest der Protestanten ausbleibt? Tut er nicht! Evangelische stimmen mit Füßen ab. Dazu reichen empirische Daten der letzten fünf Jahre aus; wie Gottesdienstbesucherzahlen, Anteil der Evangelischen, die die kasualen Dienste wie Taufe, Trauungen oder Beerdigungen noch annehmen, oder die Zahlen der Austritte.
Was auch häufig vergessen wird, ist, dass diese aktuelle Selbstbeschleunigung ggf. Ausdruck des (Nicht-)Handelns und Wahrnehmens von Kirche in der Corona-Pandemie ist. Wenn Kirche in Lebens-, Existenz- und Sinn-Krisen im Lebenssystem vor Ort nicht mehr systemrelevant (d. h. nutzlos und haltlos) geworden wahrgenommen wird, verschärft sich die Grunderkenntnis alles Evangelisch-Seins.
Denn die Botschaft im Evangelischen ist ja: Niemand braucht „Kirche“ als Form oder Struktur (mal von den Hauptamtlichen abgesehen). Denn allein im Glauben wird allein die Gnade allein im Wort Gottes mir und dir zum Evangelium. Und wenn „keine/r“ mehr – alltäglich wahrgenommen – vor Ort ist, sondern nur noch an ausgewählte „Örtchen“ (ohne Sinn- und Traditionsbezug), in unvertrauter Liturgie, zu divergierenden Zeiten oder über App vereinbarte Termine, dann suchen sich manche oder immer mehr eine neue Heimat, weil man (noch) gelernt hat: Evangelisch-Sein bedeutet – Ich bin auf mich selbst zurückgeworfen.

