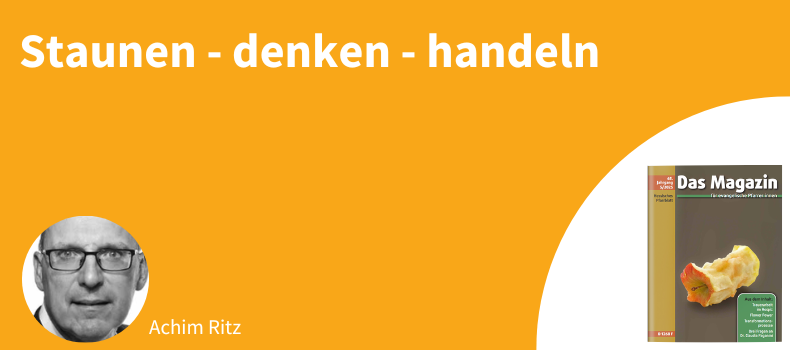
Harald Lesch nicht nur zur Energiewende
Beim „Tag für Pfarrerinnen und Pfarrer“ des Pfarrvereins in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) ging es Anfang September in der Lukaskirche (Junge Kirche) in Gießen um nichts Geringeres als die Schöpfung und das ganze Leben. Der Astrophysiker, Wissenschaftsjournalist und Philosoph Prof. Dr. Harald Lesch machte in einem unterhaltsamen und lebendigen Vortrag unmissverständlich deutlich, wie das Zusammenspiel zwischen naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und christlicher Schöpfungsethik gelingen kann und welche Handlungsschritte es braucht, um die Herausforderungen des Klimawandels gemeinsam zu meistern.
Bei aller Untergangsstimmung, die sich mit Blick auf die Umweltzerstörung, auf Kriege und Konflikte in der Welt bei manchen Menschen breit macht, bringt der Professor, der sich selbst als „Protestant vom Scheitel bis zur Sohle“ bezeichnet, mit seinen Impulsen frischen Wind in die Klimadebatte und motiviert mit einer Kernbotschaft: „Die Welt muss mehr sein als Messbares, wir können noch etwas tun.“
In der erst knapp 75 Jahre alten Lukaskirche, in der seit 2021 die Junge Kirche Gießen zuhause ist, fiel das warme Sonnenlicht durch die bunten Fenster in den Raum, in dem sich rund 120 Gäste mit dem Problem des Schwarz-Weiß-Denkens und der Spaltung in der Gesellschaft sowie dem Zusammenhang von Kosmos, Kirche und Klimawandel beschäftigten.
Zur Begrüßung sagte Gießens Oberbürgermeister Frank-Tilo Becher (SPD): „Wenn man politisch gestalten will, muss man die Sorgen der Menschen ernst nehmen und ihr Vertrauen gewinnen. Leider werden Vorschläge zur Bewältigung der Klimakrise oftmals als Bedrohung empfunden oder mit Verzicht und hohen Kosten verbunden. In der Debatte um den Klimawandel brauchen wir weniger Belehrung, sondern mehr Solidarität. Wir müssen die mitnehmen, die sich abgehängt fühlen.“ Er plädierte dafür, auf dem gemeinsamen Weg alle mitzunehmen, „denn ohne Zusammenhalt ist der beste Plan nutzlos“.
Den Appell für die Stärkung des Gemeinschaftssinns griff der aus Dresden angereiste Vorsitzende des Verbandes evangelischer Pfarrerinnen und Pfarrer in Deutschland auf. Eckehard Möller denkt an die notwendigen Veränderungsprozesse, sei es wegen des Klimawandels oder innerhalb der Kirche, in der der Mitgliederrückgang, die schwierigere Finanzlage oder etwa die Probleme bei der Gewinnung von Nachwuchs belastend seien. Doch bei allen Herausforderungen dürfe das urchristliche Anliegen der Nächstenliebe und damit die Herzlichkeit nicht vergessen werden. „Nur gemeinsam sind wir stark“, rief Eckehard Möller den Pfarrerinnen und Pfarrern zu.
Nach der Andacht mit Pröpstin Dr. Anke Spory und der Begrüßung von Werner Böck, Vorsitzender des Pfarrerinnen- und Pfarrervereins der EKHN, versuchte Harald Lesch den Faden der Vorrednerinnen und Vorredner, die für ein starkes Netzwerk aus Vertrauen und Gemeinschaft plädierten, aufzunehmen. Doch als der Naturphilosoph die Bühne vor dem Altar der Lukaskirche betrat, geschah etwas Ungewöhnliches: Der sonst im Fernsehen bei „Terra X“, „Leschs Kosmos“ oder auf YouTube so eloquente Moderator gestand mit Blick auf das, was die kirchlichen Vertreter:innen zuvor über das gesellschaftliche Miteinander und die Problemlagen postuliert hatten: „Das war alles richtig. Was soll ich jetzt noch sagen? Ich bin ein bisschen sprachlos.“
Anfangs war das Wort – und das fand Lesch nach einer kurzen mentalen Pause selbstverständlich schnell wieder. Er sprach über einen großen Moment der Stille und erinnerte die Zuhörenden daran, warum es sich lohnt, das Klima zu verbessern und sich für die Menschen und den Planeten einzusetzen. Als die drei Astronauten der Mission Apollo 8 im Jahre 1968 als erste Menschen aus dem All die Erde, diese feine, so verletzliche weiß-blaue Kugel sahen, waren sie sprachlos. Stille kehrte in der Raumkapsel ein. Das schwerelose Trio war von der Schönheit beeindruckt. „Doch was machen wir? Wir haben den Planeten mit Abfall übersät und Nano-Partikel in die Luft gebracht.“
„Leider kommen wir nicht mit der Natur in den Dialog. Wir können nicht fragen, wie es ihr geht.“ Die Redewendung, „wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus“ sei Quatsch; niemand antworte. „Auch der Watzmann ruft nicht“, sagte Lesch in Anlehnung an Wolfgang Ambros’ Song von 1974. Es sei völlig klar, was die Natur, was der Mensch brauche: saubere Luft, sauberes Wasser. Die Menschheit wisse viel. Das Universum sei aus dem Nichts entstanden. Und schon immer habe es im Raum Schwankungen, Fluktuation und Bewegung gegeben. „Unter anderen Bedingungen hätte auch alles anders kommen können. So wie diese Welt aussieht, kann sie aber nur gewollt sein, sie ist so klasse. Wir tragen natürlich auch die Verantwortung für das, was wir wissen und wie wir unser Handeln strukturieren.“
Für ihn bedeutet Schöpfung „die Schaffung von Ordnung und von immer größerer Komplexität“. Für den Naturwissenschaftler und Philosophen steht klar fest, was zu tun ist, um die Erderwärmung zu verringern. Als Handlungsreisender in Sachen Klimawandel, so beschreibt er seine Aufgabe, sei Vertrauen der zentrale Begriff seiner Arbeit. Immer wieder frage er sich, wie er es „in der naturwissenschaftlichen Seelsorge“ schaffe, bei anderen Vertrauen zu gewinnen, um gemeinsam etwas hinzukriegen. Das Thema Klimawandel müsse bei der Kirche stärker in die Gemeindearbeit integriert werden: „Es gehört auf die Kanzel und auf die Dächer.“ Lesch schlägt vor, dass Photovoltaikmodule auf allen Kirchendächern sauberen Strom produzieren sollen.
Abgesehen von den starken Argumenten und Vorschlägen, wie schädliche Emissionen reduziert werden können, wies Harald Lesch auf das gute Gefühl hin, die Freude: „Das ist so irre, wenn man zusammen was gemacht hat und das wirklich funktioniert.“ Der 65-jährige Astrophysiker betonte, dass der Mensch oft die positiven Entwicklungen der Technologie bewundere, auch für den Klimaschutz. „Staunen ist eine anthropologische Konstante“, meint Lesch. Er möchte den Bürgerinnen und Bürgern Antworten auf die großen Herausforderungen des Klimawandels und gute Empfehlungen geben und auf keinen Fall Handlungsanweisungen diktieren oder gar irgendwas verbieten.
Im Gespräch mit Harald Lesch wollte Journalistin Renate Haller, Redaktionsleiterin des Evangelischen Pressedienstes (epd), wissen, wie er sich erkläre, dass Opel und Porsche sich aus der Batterieentwicklung zurückziehen und warum seine Botschaft in Wirtschaft und Politik oft nicht ankomme. Wenn jemand in verantwortlicher Position es nicht verstehe, wie jetzt schnell gehandelt werden müsse oder sich verschließe, „frage ich mich, was haben die denn genommen?“
Als Beispiel für Ignoranz oder mangelnde Akzeptanz wissenschaftlicher Erkenntnisse nannte er das Plädoyer von Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) zur Förderung von Verbrennungsmotoren. Man könne den Wirkungsgrad des Verbrennungsmotors nicht erhöhen, stellte Lesch klar. „Deutschland bleibt im 19. Jahrhundert hängen. Mit den Verbrennungsmotoren ist es so, als würde man wieder mit offenem Feuer in der Küche kochen und heizen.“
Auch bei der Mobilität gehöre die Zukunft dem Strom, doch der Staat bezuschusse jeden Liter Diesel mit 18 Cent. „Das ist irre“, rief er den Pfarrerinnen und Pfarrern zu. Der Staat setze leider auf eine Technologie von gestern. So sei es auch der falsche Weg, wenn Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) den Bau von Gaskraftwerken fördern wolle. „Fossile Rohstoffe wie Öl, Gas und Kohle sind gespeicherte Erdzeit, die wir verbrauchen.“
Nach Leschs Überzeugung gibt es nur einen Weg, um den Kohlenstoffausstoß zu reduzieren: Solarstrom, erneuerbare Energie aus Windkraft und den Ausbau der Batteriekapazitäten. Viele Entscheidungen in der Politik und Industrie sind seiner Meinung nach von Mutlosigkeit geprägt. „Es gibt zu viele Leute, die es in Gründerjahren nicht geschafft haben, etwas zu gründen“, so Lesch zur Mutlosigkeit wichtiger Entscheidungsträger.
Er sieht eine große Chance, dass in den Kommunen mehr pro Klimaschutz umgesetzt wird. „Wir sind auf einem guten Weg, aber wir sind zu langsam.“ Auf die Frage aus dem Publikum, was er jungen Menschen sage, um ihnen im Transformationsprozess Mut zu machen, antwortete der Professor, und überraschte damit viele in der Lukaskirche: „Werdet Handwerker, denn die Energiewende braucht unsere Hände. Macht eine Berufsausbildung, so lernt ihr, wie ihr aktiv die Welt verändern könnt. Auf der Schulbank nehme man einfach Informationen in sich auf, um sie dann in Klausuren wieder abzugeben. Das Handwerk hat den großen Vorteil, dass man sich als Mensch mit anderen erlebt.“

